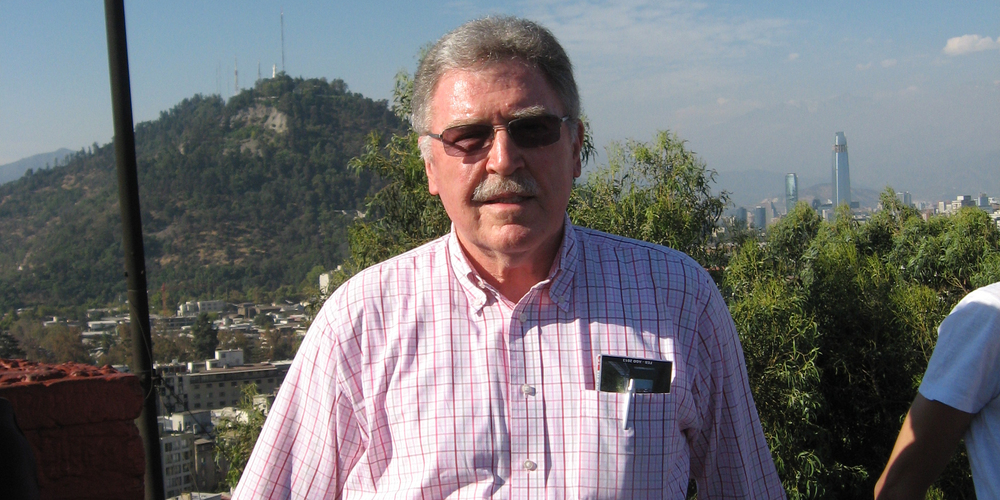mit Hans Faust
sprach Irene Lustenberger
Herr Faust, Sie wurden kürzlich für ihre Autobiografie «Ohne Matura» ausgezeichnet. Wie kamen Sie dazu, eine Autobiografie zu schreiben?
Zuerst wollte ich nur über meinen beruflichen Werdegang schreiben. Dies hauptsächlich, um jungen Leuten zu beweisen, dass man sich mit etwas Mut auch als Handwerker Lebensziele setzen und diese erreichen kann. Doch dann wurde mir bewusst, dass ich mit Erzählen ganz vorne beginnen muss, um gewisse Umstände verstehen zu können.
Sie sind im «Eckstein» in Lachen – Ecke Marktstrasse/Gangynerweg – aufgewachsen. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit und Jugend in der March?
In Träumen bin ich noch heute oft im «Eckstein». Bis zu unserer Wohnung im zweiten Stock hatte es vier Türen, die den Gang und das Treppenhaus unterteilten. Ausser unserer Wohnungstüre waren alle Türen immer offen. Das erlaubte jeder Person – auch betrunkenen Gästen von der Wirtschaft –, bis hinauf vor unsere Wohnungstüre zu gelangen. Auch diese Türe war ausser nachts nie geschlossen. In der Türe, sowie rechts und links davon, hatte es Fenster, so dass man in die Wohnung sehen konnte. Das linke Fenster konnte man sogar von aussen öffnen. Dies erlaubte, den Schlüssel, der im Schloss steckte, zu drehen und die Türe zu öffnen. Man konnte aber auch ganz einfach durch dieses Fenster in die Wohnung steigen. Obwohl bei uns nie eingebrochen wurde, fühlte ich mich nie sicher im Haus.
Sie wuchsen als Protestant in einer katholischen Gemeinde auf …
Die katholischen Festtage habe ich in lebendiger Erinnerung, diese faszinierten mich immer. Vor allem das Kapellfest war für mich ein spezielles Erlebnis. Meine Eltern erlebten dies wohl anders. Denn unsere Kunden waren fast ausschliesslich Katholiken und mit einem unüberlegten Wort, auch von mir, hätte man sie verärgern und verlieren können. Aus diesem Grund ermahnten mich meine Eltern immer, keine Dummheiten zu machen und mich anständig zu benehmen. Natürlich gab ich mir Mühe, aber in einem Dorf, wo sich alle kannten und man immer von irgend jemandem «überwacht» wurde, gab es bei schlechtem Benehmen keine Gnade. Einmal hatte ich es unterlassen, eine Person zu grüssen. Als ich nach Hause kam, hatten dies meine Eltern bereits erfahren, und ich wurde gerügt. Meine Mutter sagte dann immer: «Was müssen die Leute wohl von Dir denken?» Ein Satz, den ich bis heute in den Ohren habe.
Um immer genügend Arbeit zu haben, durften meine Eltern keines der verschiedenen Geschäfte im Dorf ignorieren, ausser der Migros. Hätte man uns dort gesehen, wären wir für die anderen Gewebetreibenden wohl Verräter gewesen. Zudem musste man in den Kriegsjahren – und auch nachher – den Gürtel enger schnallen. Sparen war überlebenswichtig, und Sackgeld gab es keines. Aber dies war für die meisten normal und zwang uns, mit dem Geldbeutel sorgsam umzugehen. Das Sparen aber verfolgte mich noch Jahre. Bei jedem Kauf fragte ich mich, ob die Anschaffung wirklich nötig war. Diesen Argwohn habe ich erst viele Jahre später ablegen können.
Seit 40 Jahren wohnen Sie in Genf. Was verbindet Sie heute noch mit Lachen?
Ich fühle mich in Genf nicht unbedingt wohl. Man ist halt nur ein «Toto», ein Deutschschweizer. Und so hatte ich im Sinn, nach der Pensionierung nach Lachen zurückzukehren. Doch dann wurde mir bewusst, dass wir hier eine vorbildliche Infrastruktur geniessen. Ich wohne in der Natur, und trotzdem sind das Einkaufszentrum, das Sportzentrum, das Schwimmbad und der öffentliche Verkehr zu Fuss erreichbar. Aber die Kontakte mit Bekannten sind nicht abgebrochen, und durch sie vernehme ich immer das Neuste aus dem Dorf.
Wenn Sie das Lachen von heute mit dem Lachen zu Ihrer Zeit vergleichen, welches sind die frappantesten Unterschiede?
Der massive Zuwachs der Bevölkerung und die wilde Bautätigkeit. Jede Ecke scheint profitabel genützt werden zu müssen – ausser das Schlachthaus der damaligen «Metzg» und der dazu gehörige, hässliche Stall. Und das mitten im Dorf an der Marktstrasse. Früher war Lachen ein bedeutender Industrieort, wo die Arbeiter zum Mittagessen jeweils nach Hause gingen. Heute ist der grösste Teil dieser Industrie verschwunden, und die Bewohner arbeiten auswärts. Irgendwie fehlen mir die damalige Geschäftigkeit im Dorfkern und sein Charme in den 60er-Jahren. Diese Entwicklung sieht man überall, und ich frage mich oft, ob dies wirklich Fortschritt ist, und wo die Lebensqualität geblieben ist.
Ihr Vater hatte eine Spenglerei. Sie durften bei der Berufswahl nicht mitreden und mussten eine Spenglerlehre absolvieren. Welches wäre ihr Wunschberuf gewesen?
Ich wollte Architektur oder wenigstens etwas Kreatives studieren.
Am Schluss hatten Sie drei Berufsabschlüsse. Welche?
Bauspengler, Sanitär-Installateur und Sanitär-Zeichner. Zudem habe ich später die höhere Fachprüfung als diplomierter Installateur im Gas- und Wasserfach bestanden, was mir erlaubt hätte, selbst Lehrlinge auszubilden. Ich tat dies aber auch, um dem Vater zu zeigen, dass ich dazu fähig war.
Nach «Lehr- und Wanderjahren» verliessen Sie 1966 Lachen. All Ihre beruflichen Stationen aufzuzählen, würde den Rahmen des Interviews sprengen. Picken wir deshalb einige Länder heraus: 1971 gingen Sie nach Indonesien, wo Sie als Projekt- und Betriebstechniker für Ciba-Geigy arbeiteten. Was war Ihre Aufgabe?
Ich war für die Überwachung sämtlicher Bauarbeiten der neuen Pharma-Produktions-Anlage, der Infrastruktur sowie der Installation der Produktionsmaschinen verantwortlich. Es war eine äusserst anspruchsvolle Arbeit, denn ich hatte ja keine Ahnung von Klimaanlagen, Stromproduktion und Kläranlagen. Gleichzeitig durfte ich aber unglaublich viel lernen.
1977 kamen Sie für zwei Monate zurück in die Schweiz. Nach einem Abstecher nach Brasilien und auf die Philippinen trudelte ein Angebot der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein. Wie kam es dazu?
Ein Kollege, der damals auch bei Ciba-Geigy in Jakarta arbeitete, hatte unterdessen eine führende Stelle bei der WHO übernommen. Immer wieder fragte er mich, ob ich nicht auch zur WHO wechseln möchte. Doch ohne Matura machte ich mir keine Hoffnung, je eine Stelle bei einer UNO-Organisation zu bekommen. Trotzdem schickte ich das ausgefüllte Anmeldeformular nach Genf und erhielt zu meiner Überraschung eine positive Antwort.
So ging es 1981 zurück in die Schweiz, und seither leben Sie in Meyrin bei Genf. Was war Ihr Job bei der WHO?
Die WHO hatte eine neue Abteilung zur Bekämpfung von Durchfallkrankheiten geschaffen. Hier brauchte man jemanden, der sich der lokalen Produktion von Oralen Rehydratations-Salzen (ORS) annahm. ORS wird zu Behandlung bei akutem Wasserverlust bei Durchfall und Cholera angewendet. Es war wohl die interessanteste Zeit meines Lebens. Sie erlaubte mir, enorm viel Neues zu lernen. Der Job bedingte viele und teilweise lange Reisen, hauptsächlich in Entwicklungsländern.
Nach 16 Jahren wurde Ihr Posten abgebaut, und Ihre Autobiografie endet am 31. März 1997. Damals waren Sie 55 Jahre alt. Was haben Sie in den vergangenen Jahren gemacht?
Zuerst versuchte ich mein Fachwissen und die Auslanderfahrung bei Projekten der Schweizer Regierung anzubieten, später bei UNO-Organisationen. Leider hatte ich nirgends Glück. Daher versuchte ich es als unabhängiger Berater und bekam so kurzfristige Aufträge von UNO-Organisationen und der Weltbank. Zufällig fand ich in Genf eine Anstellung beim Global Fund, einer neuen Organisation im Aufbau, und blieb dort fast ein ganzes Jahr, um die Büroeinrichtung für 70 Personen zu planen und einzurichten. Um mich endlich sozial in Meyrin zu integrieren, wurde ich Mitglied des Bürgervereins (AHVM) und war Co-Präsident. Unter anderem setzte ich mich für eine saubere Stadt ein und war Initiant der jährlichen Aktion «Meyrin Propre». Wir wurden auch aktiv bei der Planung eines Trams nach Meyrin und versuchten, die Linienführung zu beeinflussen, leider erfolglos. Auf diese Weise machte ich aber meine erste Erfahrung mit der lokalen Politik und deren Machtspielen.
Die Lust aufs Reisen ist Ihnen aber nie vergangen …
Das stimmt. Trotz meiner vielen berufsbedingten Reisen hatte ich meine Abenteuerlust nicht verloren und begann, mir noch unbekannte Orte zu besuchen – zum Beispiel mit dem Orient Express von Moskau nach Beijing, mit dem «Palace on Wheels» durch Rajasthan in Indien, eine Kreuzfahrt von Santiago via Patagonien nach Buenos Aires und eine weitere von San Francisco nach Hawaii und zurück.
Während mehr als zehn Jahren half ich jedes Jahr einer Bauernfamilie in Weggis bei der Kirschenernte. Leider kamen dann gesundheitliche Probleme, und so wurde mein Leben teilweise eingeschränkt. Aber ich bin dankbar für die Erlebnisse und Erfahrungen, die ich in all den Jahren machen durfte.
Sie waren in über 50 Ländern auf der ganzen Welt. Welches war das Aussergewöhnlichste und warum?
Das Aussergewöhnlichste war wohl Nordkorea. Ohne Zeitungen und Kontakt zur Aussenwelt fühlte ich mich oft wie auf einem anderen Planeten. Kontakt zu Einheimischen war unmöglich, und so fühlte ich mich dort sehr verloren und gleichzeitig ständig kontrolliert. Ich war mir bewusst, dass ich beobachtet wurde und dass es Wanzen im Hotelzimmer haben musste. Auch hatte ich das Gefühl, dass das Volk selbst wie Marionetten reagiert und andauernd Angst hat, etwas Falsches zu tun. Dafür sah ich in dem streng kommunistischen Staat mit Diktatur keine Bettler, Besoffene und Drogenabhängige sowie keine Demonstrationen. Es wurden alle immer auf Befehl beschäftigt; ein System, das man bei uns vielleicht einmal ausprobieren sollte, um unzufriedenen Bürgern die Augen zu öffnen, damit diese sehen, wie gut wir es in der Schweiz haben.
Aussergewöhnlich war auch Indonesien, wo ich wohl die schönste Zeit meines Lebens verbracht habe. Anfangs war es nicht einfach, in einer total anderen Kultur zu leben, doch mit der Zeit hat sie mich so geprägt, dass ich heute vieles anders sehe.
Gibt es ein Land, in das Sie noch gerne reisen würden?
In meinem Alter ist das Reisen kein Traum mehr. Aber zwei oder drei Wochen an einem ruhigen Ort am Meer schlage ich nicht aus. Oder wieder einmal für ein paar Tage in die Berge und die schöne Schweiz geniessen.
Sie sind an einem Sonntag geboren. Es heisst, Sonntagskinder seien Glückskinder. Was sagen Sie dazu – hatten Sie Glück, oder haben Sie sich alles hart erarbeitet?
Nein, ich habe mir nicht alles hart erarbeitet, aber vieles. Ich bin mir aber bewusst, dass ich verschiedene Male grosser Gefahr ausgesetzt war und auch trotz meiner Neugier nie böse Überraschungen erleben musste. Aber ich glaube fest daran, dass seit meiner Geburt immer ein Schutzengel bei mir ist und mich bis heute beschützt.
Die Autobiografie «Ohne Matura» von Hans Faust ist auf www.meet-my-life.net zu lesen.